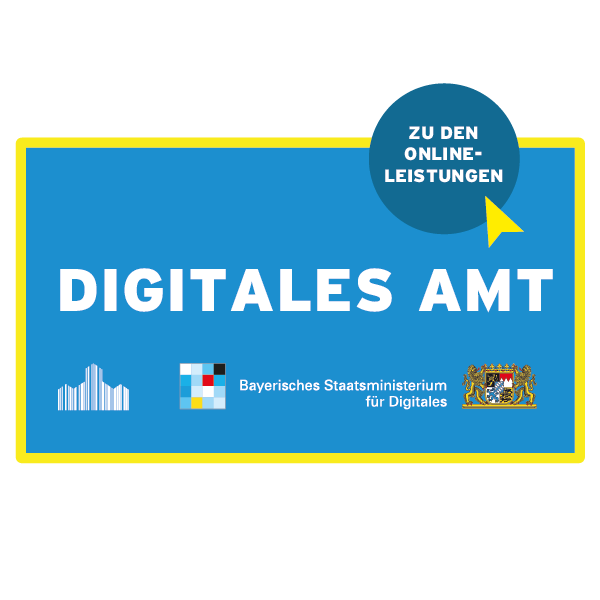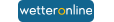Informationen der Gemeindeverwaltung
1. Ortsrecht der Gemeinde
Hier finden Sie unsere Satzungen und Verordnungen.
2. Allgemeine Informationen
2.1 Aktuelle Flyer Landratsamt
Flyer "Gut Vorbereitet in einer Gefahrensituation" Vorderseite
Flyer "Gut Vorbereitet in einer Gefahrensituation" Rückseite
3. Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung
3.1 Zurückschneiden von Hecken und Gehölzen
Die Gemeinde Grettstadt macht auf das Schneideverbot von Gehölzen von März bis Ende September aufmerksam. Das Bundesnaturschutzgesetz verbietet es während der Brutzeit der Vögel (1. März bis 30. September) Hecken, Gebüsche und andere Gehölze abzuschneiden. Ausnahme: schonende Form und Pflegeschnitte.
Bäume in Privatgärten dürfen nach vorheriger Untersuchung auf Nist- oder Brutplätze gefällt werden, wenn sich kein Nest dort befindet. Im Einzelfall können Ausnahmen genehmigt werden, wofür die Untere Naturschutzbehörde (09721-55 573) zuständig ist.
3.2 Gehsteige und Straßen Reinigung und Reinhaltung – Winterdienst
Die hiefür einschlägige Verordnung verpflichtet die Grundstückseigentümer bzw. Nutzungsberechtigten der Grundstücke zur Vornahme von Reinigungsarbeiten bzw. den Winterdienst. Zu den „Straßen“ gehören die Fahrbahnen, die Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen, die Geh- und Radwege. Als Gehbahn zählt im herkömmlichen Sinne der für den Fußgänger. bzw. Radfahrerverkehr bestimmte, befestigte und von der öffentlichen Straße abgegrenzte Teil (Gehsteig bzw. Bürgersteig). Sollte ein solcher fehlen, was in den neuen Baugebieten, die als „verkehrsberuhigte Bereiche“ ausgewiesen sind, der Fall ist, so ist am Rande der Fahrbahn ein 1 m breiter Streifen als Gehbahn anzusehen. Die Verordnung untersagt die öffentlichen Straßen mehr als nach den Umständen vermeidbar zu verunreinigen oder verunreinigen zu lassen.
Reinigungspflicht
Die Reinigungsfläche umfasst die vor den Grundstücken liegenden Gehwege und die Fahrbahn bis zur Straßenmitte evtl. vorhandene Parkstreifen und ist jeden Samstag zu kehren. Der Kehricht, Schlamm und sonstiger Unrat ist zu entfernen. Fällt auf den Reinigungstag ein Feiertag so sind die genannten Arbeiten am vorausgehenden Werktag durchzuführen. Bei Trockenheit ist zur Vermeidung von übermäßiger Staubentwicklung zu sprengen, wenn die Reinigungsfläche nicht staubfrei angelegt ist. Die Reinigungsfläche ist von Gras und Unkraut zu befreien. Ferner sind bei Bedarf, insbesondere bei Tauwetter, die Abflussrinnen und die Kanaleinlaufschächte freizumachen.
Winterdienst
Hier gilt auch die vorgeschilderte Reinigungsfläche. Diese ist an Werktagen ab 7 Uhr und an Sonn- und gesetzlichen Feiertagen ab 8 Uhr von Schnee zu räumen und bei Schnee-, Reif- oder Eisglätte mit geeigneten abstumpfenden Mitteln (z.B. Sand, Splitt), nicht jedoch mit ätzenden Mitteln zu bestreuen oder das Eis zu beseitigen. Diese Sicherungsmaßnahmen sind bis 20 Uhr so oft zu wiederholen, wie es zur Verhütung von Gefahren für Leben, Gesundheit, Eigentum oder Besitz erforderlich ist. Der geräumte Schnee oder die Eisreste (Räumgut) sind neben der Gehbahn so zu lagern, dass der Verkehr nicht gefährdet oder erschwert wird. Es ist verboten, den Schnee oder das Räumgut in die Fahrbahn zu verbringen. Abflussrinnen, Hydranten, Kanaleinlaufschächte und Fußgängerüberwege sind bei der Räumung freizuhalten. Für weitere
4. Abgabe von Elektrokleingeräten im Bauhof der Gemeinde Grettstadt
Ab sofort können im Bauhof der Gemeinde Grettstadt Elektrokleingeräte (Rasierapparat, Handy, Fön, Toaster, PC, Fernseher, Bildschirme o.ä.) kostenlos abgegeben werden. Für Haushaltsgroßgeräte stehen nach wie vor die Abholung bei der Sperrmüllabfuhr oder die kostenfreie Abgabe beim Abfallwirtschaftszentrum Rothmühle zur Verfügung.
Elektrokleingeräte werden zu folgenden Zeiten angenommen:
jeden Freitag von 11:45 Uhr -12:00 Uhr am Bauhof Grettstadt
5. Hundehaltung
5.1 Hundesteuer
Das Halten eines über vier Monate alten Hundes im Gemeindegebiet unterliegt einer gemeindlichen Jahresaufwandsteuer. Die Steuer beträgt für den ersten Hund 40,00 €, für den zweiten 60,00 € und für jeden weiteren Hund 80,00 €.Die Steuer für Kampfhunde nach der Verordnung über Hunde mit gesteigerter Aggressivität und Gefährlichkeit vom 10. Juli 1992 (GVBl S. 286, BayRS 2011-2-7-I) in der jeweils gültigen Fassung beträgt jährlich 500,00 €. Die Anmeldung der Hunde hat unaufgefordert im Steueramt der Gemeinde zu erfolgen.
5.2 Hundehaltung
In der Gemeinde Grettstadt gilt die Verordnung über das freie Umherlaufen von großen Hunden und Kampfhunden, die sogen. Kampfhundeverordnung. Als große Hunde zählen Hunde mit einer Schulterhöhe von mindestens 50 cm. Die Eigenschaft des Kampfhundes bestimmt sich den landesgesetzgeberischen Verordnungen. Für die großen Hunde und Kampfhunde gilt in allen öffentlichen Anlagen sowie auf allen öffentlichen Wegen, Straßen und Plätzen im gesamten Gemeindegebiet (hiermit sind die bebauten Gebiete gemeint) zu jeder Tages- und Nachtzeit Anleinpflicht. Die Leine selbst muss reißfest sein und darf eine Länge von drei Metern nicht überschreiten.